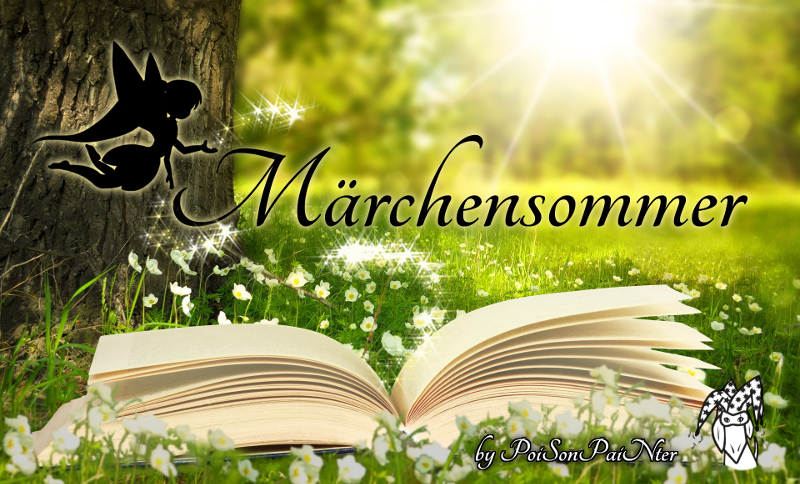Die Grundlagen gelegt, hier nun der zweite Teil von Palandurwens Fairy Tale Summer Gastbeitrag zu den Meerjungfrauen von u.a. Hans-Christian Andersen – jetzt geht es um die Flossen!.
Tief Luft holen: Die Meerjungfrauen des 19. Jahrhunderts
Frauen wurden also lange Zeit schon als Unheilbringerinnen gezeichnet. Sie galten als verführerisch, was die Männer anzog, aber gleichzeitig auch in Gefahr brachte. Sie wurden mit der Natur gleichgesetzt, u. a. eben dem Wasser. Doch genau wie bei diesem Element wollte der Mensch – um genau zu sein der Mann – auch die Frau als für ihn nutzbar gestalten, sie kontrollieren und dadurch seine Macht demonstrieren.
Es traten also immer häufiger Erzählungen auf, in denen die weibliche Hauptfigur – einst frei, ungehemmt, mit eigenen Gedanken und Wünschen – aus irgendwelchen Gründen erlöst oder gerettet werden musste, um eine höhere Ebene erreichen zu können. Und selbstverständlich konnte diese Ruhmestat nur ein Mann vollbringen.
Um diesem Narrativ Gestalt zu verleihen, wurden die Meerjungfrauen aus den Untiefen hervorgezogen. Ihnen wurde eine Erlösungsbedürftigkeit angedichtet, untermauert mit diversen religiösen Spielarten, um dem Bild eine quasi göttliche Legitimierung zu verleihen. Demnach hatten sie keine Seele, waren dadurch also verdammt. Um diesen Umstand auszuräumen, gab es nur einen Weg: die Liebe eines Mannes. Diese wurde allerdings meist mit der Ehe gleichgesetzt, bei der es sich zu jener Zeit aber eher um einen wirtschaftlichen Vertrag zwischen zwei Herren (Vater und Bräutigam) handelte und die Frau das zu verschachernde Gut war. Somit hatte hier nie wirklich jemand ihr Wohl im Auge. Es wurde nur eine weitere Begründung für die gängigen Zustände gesucht.
Denken wir diesen Gedanken einmal ein Stückchen weiter, könnten wir sogar so weit gehen und sagen, dass Frauen vor der Hochzeitsnacht keine Menschen waren, sondern vermeintlich nur durch die Zusammenkunft mit dem Ehemann an Wert gewannen. Die ohnehin schon stets der Weiblichkeit entgegen gebrachte Skepsis und Verachtung gipfelt hier also in zunächst einer völligen Entmenschlichung, die durch einen sexuellen Akt (die Hochzeitsnacht) erst “behoben” wird. Ein erneutes hierarchisches Gefälle auf Kosten der Frau.
Genau diese Entwicklung ist in Friedrich de la Motte Fouqués “Undine” zu beobachten. Zu Beginn ist sie ein ungestümes Wesen, wunderschön, mit lauter Stimme. Sie ist neugierig, sie lacht und ist manchmal auch ein wenig egoistisch. Eine von der Gesellschaft losgelöste, junge Frau. Kein Wunder, dass sie die Aufmerksamkeit des Ritter Huldbrands auf sich zieht. Natürlich gerät dieser durch ihre Schuld zunächst einmal in eine gefährliche Situation. Dennoch würde er sie gern zur Frau nehmen.
Gesagt, getan. Und als wäre ein Dämon in der Hochzeitsnacht in sie gefahren, verliert Undine in dieser all ihre vorab so reizvollen Eigenschaften. Sie wird sanft, geduldig, demütig – und still. Sie versucht sogar, ihren Mann vor ihrer Familie aus Wassergeistern zu schützen. Doch letztendlich kommt es zum Zerwürfnis, die Wasserfrau muss zurück zu ihren Verwandten und soll, als der Ritter erneut heiraten will, diesen auf Geheiß ihres Vaters töten. Selbst jetzt versucht sie, ihn zu retten. Doch sie kann es nicht verhindern und gibt ihm in der Nacht vor seiner Hochzeit einen tödlichen Kuss. Aus Trauer darüber wird sie zu einer Quelle auf seinem Grab.
Undine ist eine tragische Figur, die betrogen und gezwungen wird. Denn im Laufe der Geschichte kommt heraus, dass es eben ihr Vater war, der sie dazu getrieben hat, überhaupt erst eine Ehe einzugehen, um eine unsterbliche Seele zu erlangen. Sie ist somit – ganz im gesellschaftlich bekannten Sinne – ein Spielball zweier Männer und wird am Ende dennoch als Unheilsbringerin stilisiert. Sie verliert alles, was sie ausmacht, alles, was sie liebt. Sie gibt sich selbst völlig auf, um zwei Männern zu gefallen. Die Frau wird leidend, ja märtyrerhaft dargestellt. Es erinnert an christliche Motive, in denen der fast schon dankbar erduldete Schmerz der Schlüssel zum Seelenheil sei. Die Gewalt und den Zwang im Leben zu ertragen, soll somit also der Weiblichkeit erstrebenswert gemacht werden. Und mit solchen Versprechungen zementiert sich das ewige Machtgefälle weiter fest.
Eine Schippe drauf legte einige Zeit später Hans Christian Andersen. Auch er verfasste ein Kunstmärchen, das uns allen wohl spätestens seit Disneys “Arielle” bestens bekannt ist – oder etwa doch nicht? Tatsächlich hat der Zeichentrickfilm kaum etwas mit dem dänischen Original zu tun.
In “Die kleine Meerjungfrau” strebt die Heldin immerhin aus eigenem Willen danach, eine unsterbliche Seele zu erringen, zusammen mit der Liebe eines jungen Prinzen. Diesen hatte sie vor dem Ertrinken gerettet, obwohl sie das nicht durfte. Ein weiteres Anzeichen einer gewissen Selbstständigkeit. Doch die wird sie nicht lange behalten dürfen.
Um sich ihre beiden Wünsche zu erfüllen, nimmt sie die gefährliche Reise zur Meerhexe auf sich. Diese braut ihr einen Trank, der ihr unter großen Schmerzen zwei Beine wachsen lässt, auf denen sie zwar nach wie vor einen fast schwebenden Gang hat, jedoch jeder Schritt ist, als trete sie in Glas. Der Preis dafür: Sie wird für immer stumm und kann nie wieder zu ihrer Familie zurück. Wenn der Prinz sich nicht in sie verliebt, wird sie zudem zu Meerschaum werden.
Sie trifft auf den besagten Königssohn, dem sie auch gefällt. Allerdings nicht wie eine Frau und Partnerin, sondern wie ein kleines Kind. Als solches erfährt sie mit einer Selbstverständlichkeit diverse Demütigungen, welche sie geduldig hinnimmt. So schläft sie beispielsweise auf einem Kissen vor seiner Tür statt in einem Bett.
Als der Mann sich schließlich entscheidet, eine andere zu heiraten, kommen die Schwestern der Meerjungfrau ihr zur Hilfe. Sie überreichen ihr einen magischen Dolch. Wenn sie den Prinzen mit diesem ersticht, wächst ihr Fischschwanz wieder und sie darf zurück nach Hause. Doch sie kann es nicht, wirft das Messer ins Meer und springt hinterher. Statt zu Meerschaum wird sie durch diese selbstlose Tat allerdings zu einer Tochter des Windes und kann, wenn sie weiter Gutes bewirkt, doch noch irgendwann eine unsterbliche Seele erlangen.
Klingt tragisch-schön? In der Tat. Allerdings zeichnet der Erzähler auch hier wieder ein Frauenbild, welches hochgradig toxisch ist. Um dem Mann zu gefallen, darf sie nicht sprechen, muss Schmerzen und Demütigung erdulden und kann nur durch ihren Körper seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und trotz all des Leides wählt sie am Ende den Freitod, die totale Selbstaufgabe, um ihn zu schützen. Aber selbst dadurch erhält sie keine wirkliche Belohnung, sondern muss sich weiterhin beweisen, um ihr Ziel zu erreichen. Das Machtverhältnis bleibt also sogar nach ihrem Tod bestehen.
Andersens Meerjungfrau spiegelt die damalige kleinbürgerliche Geschlechtermoral somit sehr deutlich wider. Die Frau wird einerseits als aufopferndes Wesen, andererseits als unschuldig-naiv gezeichnet. Die kleine Meerjungfrau ist zwar liebreizend und versucht zu gefallen. Sie nimmt auch alles Leid als Lebensinhalt für das höhere Ziel in Kauf. Aber wenn der Mann es nicht will, erreicht sie dieses nie. Die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Geschlechtern werden hier beeindruckend erkenntlich.
Man reiche mir ein Handtuch: das Fazit
Während Frauen in den tradierten Erzählungen, Sagen, Mythen und Märchen immer entweder gruselig und mächtig oder aber liebreizend und hilflos waren, zeigen die Kunstmärchen uns eine andere Art der Weiblichkeit. Sie ist anfangs facettenreicher, doch es wird auch eindeutig kommuniziert, dass das unerwünscht ist. Die angedachte Rolle der Frau ist klar abgesteckt. Erst, wenn sie dem Wunsch des Mannes entspricht, kann sie Glück erfahren. Und selbst dann nur so lange, wie es ihm gefällt. Ihm wird jegliche Dominanz zugesprochen und diese mit einer scheinbaren Allgemeingültigkeit, weil es ja auch im echten Leben so ist, legitimiert.
Niemand hinterfragt diese Darstellung. Keinem fällt daran etwas auf. Es wird als gegeben betrachtet. Der Deckmantel der Romanze darüber ausgebreitet. Doch der kann kaum den wahren Kern der Sache verbergen. Wir müssen uns nur trauen, hinzuschauen. Uns der Erkenntnis stellen, dass unsere Märchen in diesem Punkt Wunden reißen – seit Generationen. Und wir müssen uns darin einig werden, diese endlich zu schließen. Indem wir das Bewusstsein dafür schüren und die richtigen Fragen stellen. Indem wir das Wissen annehmen und daraus lernen. Und indem wir damit wunderschöne neue Märchen entstehen lassen, die die Welt so zeigen, wie sie hoffentlich eines Tages auch wirklich ist.
Die Gastautorin
Palandurwen macht im echten Leben für andere etwas mit Wörtern. Dafür muss sie nicht einmal ihr malerisch im Elbtal, direkt an einem Weinberg gelegenes Zuhause verlassen. So kann sie sich rund um die Uhr von ihrer Katze herumkommandieren lassen, ob sie arbeitet oder in ihrem Atelier malt und scrapbookt. Märchen haben sie schon seit frühester Kindheit fasziniert und inspiriert. Doch spätestens durch ihr Germanistik-Studium scheut sie sich nicht mehr, diese auch kritisch zu hinterfragen, immer mit dem Ziel, irgendwann ein eigenes verfassen zu können.
Instagram: @palandurwen
Twitch: palandurwen
Anne/PoiSonPaiNter